Sonne. Wir fahren auf den Parkplatz an einigen Polizeiautos vorbei. Einige der Polizist*innen stehen davor und tippen auf ihren Handys herum oder rauchen. Unser Blick streift sie nur flüchtig, denn wir wenden uns schnell dem Geschehen hinter der Mauer, vor dem ein „betreten Verboten“ Schild steht zu, passieren diese und stehen unter einer Brücke; die Autos, die darüber fahren klingen wie ein fernes Rauschen.
Unsere Gruppe teilt sich auf, denn es stehen verschiedene Arbeiten an. Ich zünde mir eine Zigarette an und schaue mich um. Auf den steinernen Grund stehen Zelte in verschiedenen Farben, manche sind mit Decken umschlungen zu kleinen Häuschen geworden, die gemütlich aussehen und mich ein bisschen an die Zeit erinnern, in der ich als Kind draußen schlafen wollte und das ein großes Abenteuer war. Und auch jetzt muss ich zugeben, dass es sich nicht komplett real anfühlt dort zu stehen in dem Wissen, dass hier Menschen leben. Trotzdem weiß ich was zu tun ist, nehme mir ein paar Einweghandschuhe, ein paar Arbeitshandschuhe, ein paar Müllsäcke und gehe an den Hang, der zum Fluss führt und vor lauter verschiedener Klamotten und Plastik ganz bunt ist. Auf meinem Weg begrüße ich ein paar Leute, mit manchen unterhalte ich mich auf Englisch, manche können ein wenig Deutsch und mir wurden hier ein paar Worte arabisch beigebracht. Kefek? Tamam. Es geht um verschiedenes: das Wetter, die Sprache, Handys, Schuhe, Fußball, die Flucht bisher und wie sie weitergeht. Germany bueno. No bueno?
Wir bemühen uns und spielen unbekümmert. Lachen viel, rauchen und essen gemeinsam. Und doch wären wir alle sicher gern woanders als unter einer Autobahnbrücke in Ventimiglia, Italien, dessen Sonnenuntergang am Strand stehend so ein schönes Panorama bietet, doch mit der Dämmerung setzt auch die Kälte ein, die mich an die Nacht in meinem Zelt in Frankreich erinnert. Dahin fahren wir Abends zurück. An den Grenzkontrollen, die nach einem kurzen Blick auf unseren blauen Skoda mit Bielefelder Kennzeichen einen Blick in unser Auto werfen, weiße Hautfarbe sehen und uns mit einem kurzen „Okay.“ durchwinken vorbei. Ein ums andere Mal sprechen wir über die Möglichkeit jemanden im Kofferraum oder der Dachbox versteckt über die Grenze zu helfen, doch bei Aussicht auf fünf Jahre Gefängnis verläuft sich die Ernsthaftigkeit dieses Gespräches wieder gefolgt von einem kollektiven Shitstorm auf ein geheimnisvolles System, das wir vage als „den Kapitalismus“ betiteln.
Wenn ich den nach Urin stinkenden Müll in eine Plastiktüte stecke, frage ich mich, was sinnvolle Arbeit ist. Alles, was wir unten in Ventimiglia machen ist nichts als minimalste Schadensbegrenzung. Einige Menschen schaffen es nach Frankreich und hoffentlich in ein besseres Leben, aber es werden neue Menschen kommen. Manche von ihnen waren schon in Ventimiglia, wurden bei spontanen Räumungsaktionen der Polizei in einen Reisebus in den Süden nach Taranto gebracht und stehen einige Zeit später wieder genau an der selben Stelle. Manche kennen sich noch gar nicht aus. Wenn wir sie Abends beim Monitoring im Bahnhof treffen sagen wir ihnen, dass sie unter der Brücke oder im Roten Kreuz Camp schlafen können. Ins Rote Kreuz Camp durften wir nicht eintreten ohne uns registrieren zu lassen, aber aus Erzählungen haben wir gehört, dass die Bedingungen dort nicht besser seien. Minderjährige Frauen ohne Begleitung werden dort nicht aufgenommen, es sei eine zu große Verantwortung. Die Geflüchteten müssen, um dort Schutz finden zu dürfen, Fingerabdrücke abgeben, die sie auch nach gelungener Flucht noch sechs Monate an Italien binden würden. So lange bleiben die Abdrücke gespeichert und ein Land wie Deutschland könnte sie sich auf Dublin berufend nach Italien zurück abschieben. Die Menschen, die Deutsch sprechen, haben häufig für einige Zeit in Deutschland gelebt, bevor sie durch dieses Verfahren wieder am Bahnhof von Ventimiglia gestrandet sind und es von neuem versuchen werden.
So ziehen sie zum Teil mit ihren Kindern unter die Brücke und schlagen dort ihre Zelte auf, wenn sie welche haben oder andere Geflüchtete ihre zur Verfügung stellen. Ihre provisorischen Lebensmittelpunkte bezeugen wie wenig Interesse besteht, lange an diesem Ort zu bleiben. Ein Freund von mir hat erzählt, wie er gesehen hat, dass einem anderen Geflüchteten von einem Cop fünf Mal ins Gesicht geschlagen wurde, doch der zeitliche Aufwand ein Gerichtsverfahren einzuleiten wäre zu intensiv, schließlich will er in ein paar Tagen wieder versuchen über die Grenze zu kommen und das hinter sich zu lassen. Wenn nicht Druck durch das Erfahren staatlicher Ablehnung, kommt er aus den Strukturen unter der Brücke selbst, denn überall, wo Menschen schutzlos sind, kann sich besonders gut an diesen bereichert werden. Keine Polizei, die sich für sie einsetzen würde, wenn sie durch Mafiastrukturen bestohlen und gedemütigt werden. Kein Geld, das sie legal verdienen könnten, denn es gibt keine Arbeit, die sie ausüben dürfen.
Aus meiner Perspektive eines Menschen, der all das wann er mag hinter sich lassen und nach Hause fahren kann, ist es kaum zu erahnen, was Menschen in solchen Situationen tun müssen, um dem Leben unter der Brücke zu entkommen. Noch weniger steht es mir zu darüber zu urteilen, weil mein Bauch voll ist und ich alles werden kann, was ich will.
„So many young people are here. They have dreams.“ sagt mein Freund zu mir und ich kann nur dumm nicken.
Ich kann nur vermuten, wie sich das Leben unter der Brücke wirklich anfühlt, nur vermuten, was für den Traum einer Arbeit nachgehen und der Familie Geld nach Hause schicken zu können, aufgegeben werden muss.
Diese Vermutungen belasten mich emotional, weil die Refugees, die diese betreffen, keine Pixel im Fernseher sind, sondern Gesichter, Namen und Geschichten.
Ich fahre in drei Tagen zurück nach Hause. Das sage ich meinem Freund und beiße mir auf die Zunge.






![Für Buchvorstellung: Mail an nobordernoproblem[ät]posteo.de](https://nobordernoproblem.org/wp-content/uploads/2019/08/973F2C08-EDDC-44A4-A4E2-19FE4CEFF44D-700x1130.jpeg)





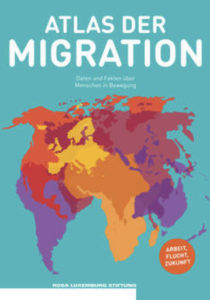

Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.