Dieser Text wurde von einem autonomen Aktivsten geschrieben und schildert ausschließlich seine individuelle Perspektive.
Ein ehemaliges Elektrizitätswerkkurz hinter dem Bahnhof von Caen in der Normandie wird derzeit von Menschen verschiedenster Nationalitäten bewohnt. In vier Gebäuden, die auf dem weitläufigen Gelände verteilt stehen, findet der Alltag von Familien und Einzelpersonenstatt, die im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs als „Flüchtlinge“ zusammengefasst werden. Ich, deutsch, männlich, lebe auch nun seit fünf Wochenhier im Squat. Er existiert seit letztem April und beherbergt etwa 200Menschen. In Caen gibt es noch sieben weitere Squats, die größtenteils selbstorganisiert funktionieren und dievon Geflüchteten bewohnt werden.
Ein Squat ist im Grunde nichts anderes als ein besetztes Haus, sprich ein ungenutztes Gebäude, welches im Zuge einer Besetzung nutzbar gemacht wird. Der Nutzen kann je nach Eigenschaften des Gebäudes variieren und so u.A. Ausstellungsort, Fußballplatz, Skatepark, Bürooder (temporär) Zuhause sein. Da dieses Gebäude Waschräume und WCs, viele Einzelzimmer und Küchen bietet, so also die Mindestanforderungen für Lebensraum erfüllt und leer stand, wurde er von derAssemblé Génerale de lutte contre tout les expulsions (Generalversammlung fürden Kampf gegen alle Räumungen, kurz: AG) besetzt. In Frankreich wird es denHausbesetzer*innen de jure dadurch vereinfacht, dass eine Haubesetzung innerhalb von 48 Stunden geräumt werden muss. Ist dies nicht der Fall, muss gerichtlich die Zukunft des Hauses erstritten werden und bis ein Prozess erstmal startet, kann einige Zeit vergehen.

Besagte AG ist eine französische Gruppe bestehend aus Menschen verschiedenster politischer Hintergründe, die das Ziel eint, Geflüchtete unterstützen zu wollen. Der aktivistische und zumeistlinksradikale Teil öffnet, der andere Teil verwaltet die Gebäude anschließend. Final sollen die Häuser dann selbstorganisiert, den Geflüchteten überlassen ohne die AG weiter bestehen. Im Weiteren wird noch auf diese Gruppe eingegangen.
Die Menschen, die hier wohnenwollen, müssen vorher mehrfach die 115 angerufen haben; das ist eine frankreichweite Telefonnummer, unter der man sich melden kann, wenn man keine Bleibe für die Nacht hat. Dort muss man mehrfach Absagen bekommen, dann kann man in den Squats schlafen.
Ich lebe zusammen mit meinen Freund*innen im Gebäude A, links vom Eingangstor. Davor ein kleiner Garten mit Kompost. Wenn ich aus unserem Raum, ganz oben in der zweiten Etage nach unten hinausgehe höre ich das lebendige Treiben, die drei Waschmaschinen laufen ständig, die Kinder kindern, Menschen begrüßen mich je nach Bekanntheitsgrad ganz unterschiedlich. Am Freeshop, wo heute schon gekochter Reis in Plastiktüten drin liegt und dem merkwürdigen, durchgesuppten Loch an der Decke,den Waschräumen gehe ich vorbei und dann stehe ich draußen. An manchen Tagen ist das Wetter noch richtig freundlich, sodass die Kinder Fußball, Basketball oder irgendwas spielen, herum streunern oder schaukeln und manchmal Anschwung brauchen.
In der Community Kitchen, die derzeit von uns als Ort zum Arbeiten, Kochen und Sein verwendet wird, malen sie oder wollen beim Gemüse Schneiden helfen. Einige von ihnen sprechen französisch und fragen mich auch nach wie vor manche Dinge auf dieser Sprache, obwohl ich schon so oft gesagt habe, dass ich´s nicht verstehe. Mit den ganz Kleinen verständige ich mich zumindest durch Zunge raus strecken, auskitzeln und „Arrêt“. Wenn sie schon mal in Deutschland waren, sprechen einige der Kindersogar Deutsch. Es ist beeindruckend wie leicht es ihnen scheint Sprachen zu lernen.
Natürlich sprechen Alle hier verschiedene Sprachen. Arabisch, Albanisch, Französisch, Englisch und welche, die ich nicht kenne. Leider verstehe ich nur Englisch. Zwar sprechen einige der Bewohner*innen ebenso Englisch, weshalb wir uns gut unterhalten können, dieSprachbarriere bleibt aber natürlich bestehen. Dies ist sehr schade, denn alle Menschen hier haben sehr viel Spannendes zu berichten und tun dies glücklicherweise manchmal ohne Umschweife in einem Mix aus sämtlichen Sprachen und vielen Gesten. Es ist sehr interessant und lehrreich von meinen Freund*innen aus Nigeria oder dem Sudan Geschichten aus deren Heimat, „wie es dort soläuft“, erzählt zu bekommen und zu verstehen wie vielfältig die Lebensrealitäten sein können. Ich bekomme ständig gezeigt wie naiv es wäre meine eigene Lebensrealität als Ausgangspunkt einer Weltbetrachtung zu nehmen und daraufhin Schlüsse zu ziehen. Nichtsdestotrotz kann das Aufeinanderprallen der ganzen Geschichten Ursache für Konflikte sein, vor allem dann, wenn wie hier der Lebensraum geteilt wird. Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, Sozialisierungsformen, Sprachen, Verhaltensweisen, Problemen und so weiter leben hier zusammen.
Ein Teil der Arbeit hier ist definitiv die Betreuung der Kinder, die wir abends um acht aus der Küche schicken, weil sie am nächsten Tag zur Schule gehen. Zudem machen wir hier rundum den Squat kleinere Arbeiten, wie unseren cleaning day einmal pro Woche. Unser Hauptaugenmerk richtet sich jedoch eher auf die Arbeit in Ouistreham. Dies ist ein Ort mit Hafen, von wo aus täglich Fähren nach Portsmouth ablegen. Etwa 150 Geflüchtete, zumeist aus dem Sudan, leben deshalb auf den Straßen dieses Orts, um immer wieder ihr Glück zu versuchen. Auf einem kleinen Parkplatz bieten wir daher vier Mal pro Woche Frühstück, Duschen, Tee und eineHandyaufladestation an. Es ist erschreckend zu hören, unter welchen Umständendie Menschen dort teils seit Monaten leben müssen, abseits der Polizeigewalt und Witterung, der nun ansehenden Wintermonate. Spenden in Form von alten Smartphones, warmer Kleidung und Decken helfen auf jeden Fall sehr.
Um das Frühstück ausgewogen und abwechslungsreich zu gestalten, brauchen wir verschiedene Spenden. Viel kommt von außerhalb, aus den Bäckereien, die ihre Ware nicht vollständig losgeworden sind oder aus einem Supermarkt, zu dem wir morgens gelegentlich fahren und nicht mehr ganz frisches Obst und Gemüse abholen können. Zusätzlich gehen wir mehrmals pro Woche containern. Das bedeutet, dass wir nach Ladenschluss zu Supermärkten fahren, von denen wir wissen, dass in ihren Abfalleimern, die gut zugänglich hinter den Läden stehen, noch gutes, aber schon entsorgtes Essen zu finden ist. Hierbei starren mich manchmal wahre Schätze aus den Tiefen der Mülltonnen an: Asterix Comics, lustige Perücken, tausende Jelly Bellys, Unmengen an Obst und Gemüse, einmal hatten wir 100 Liter Milch, Tüten voller Gebäck und zum krönenden Abschluss Bier! Dies nehmen wir uns mit, reinigen es und konsumieren es entweder selbst, legen es in den Freeshop im Squat oder können es sogar in Ouistreham verteilen. Die verschiedenen Quellen gewährleisten kostengünstigen und ausreichenden Zugang zu Essen, sodass wir in Ouistreham Brot mit verschiedenen, selbstgemachten Aufstrichen oder Sweetrice mit Kokos und zusätzlich fast immer irgendein Obst und ein paar Kekse anbieten können.
All dies planen und besprechen wir in unseren Meetings, die wir zwei Mal pro Woche abhalten. Die Meetings sind relativ kurz und aushaltbar, weil die Gruppe zwischen drei und sechs Leute groß ist. Die Größe der Gruppe ist abhängig von Krankheiten und Urlauben, die man nicht versäumen sollte sich zwischendurch zu genehmigen. Denn obwohl wir versuchen hierarchiefrei zu arbeiten, ergeben sich Mechanismen und Abhängigkeiten, die ermüdend und erst durch zwischenzeitliche Distanzierung erkennbar sind. Zudem stellt sich schnell ein Alltag mit bekannten Abläufen ein, die einige Zeit zu verlassen, wohltut. Insgesamt bietet der Squat zunächst Sicherheit und Unterschlupf, was gerade für Familien mit Kindern sehr wichtig ist.

Dieses Privileg sollte man sehr zu schätzen wissen. Viele der Menschen hier haben ohne Papiere und Geld nicht einfach die Möglichkeit eine Auszeit zu nehmen. Wenn ich selbst merke, was mich hier stört und daraufhin sauer werde, vergegenwärtige ich mir, dass ich als einer der Wenigen hier, nach einer geplanten, bestimmten Zeit einfach in mein Zuhause in Deutschland aufbrechen kann, wo es eine Dusche und ein Klo gibt, die ich mir nicht mit vielen anderen teilen muss, wo ich meine Familie sehen kann, wo ich eine Perspektive auf Arbeit und sichere Existenz habe. Wenn ich dann reflektiere, dass ich mich gerade über ein ungeputztes Klo echauffiert habe, entlarvt das lediglich wie gut es mir eigentlich geht. In der Tat ist die Hygienesituation für Alle ein Problem. Für die etwa 200 Squatbewohner*innen gibt es in den vier Gebäuden insgesamt etwa 20 Toiletten und 10 Duschen, von denen durch natürlichen Verschleiß noch etwa 10 Toiletten und 5 Duschen nutzbar sind, was schnell unangenehm sein kann, besonders wenn man bedenkt, dass der Squat für einige das aktuelle Zuhause ist. Die Meisten versuchen demnach die Hygieneräume sauber zu halten, aber für bestimmte Klempner*innenarbeiten bedarf es neben dem entsprechenden Equipment, Kompetenz und Zeit. Es steht sogar Geld für den Squat zur Verfügung, welches durch die AG – die Gruppe, die die Squats begleitet – verwaltet und über welches in deren Meetings gesprochen wird. Problematisch ist hierbei jedoch, dass die Meetings, die als offen und für Alle zugänglich gelabelt sind, ausnahmslos auf Französisch sowie teilweise in für Migrant*innen unzugänglichen Räumen, nämlich dem AG Büro, welches durch einen Code versperrt ist, abgehalten werden. Also nichts mit Partizipation. Das ist natürlich völlig absurd, wenn man bedenkt, dass das Geld gespendet wurde, um Migrant*innen zu helfen. Doch statt sie in die Meetings einzubinden, sie zu fragen, was für Bedürfnisse sie eigentlich haben, wird über ihre Köpfe hinweg über Geld entschieden, als könnten allein Weiße die Welt retten. Auf Nachfrage, warum die Meetings in diesem exklusiven Rahmen abgehalten würden, heißt es z.B. die Migrant*innen hätten kein Interesse an Politik. Nun gut. Hier wird der Rassismus in Verallgemeinerung und Unterstellung offensichtlich, den auch eine eigentlich linke Gruppe in sich zu tragen scheint. Es wäre jedoch falsch zu behaupten in der AG regte sich kein Widerstand dagegen, sodass die „militants“ (hat nichts mit Steine schmeißen zu tun, ist wohl die übliche Bezeichnung für „Aktivistis“ auf Französisch). Einen bezeichnenden Moment habe ich beim Festival hier erlebt. Die AG veranstaltete am 5. und 6. Oktober ein Festival bei dem u.a. ein Theaterstück aufgeführt wurde, in dem ausschließlich französisch sprechende Weiße gespielt haben, auf einem Boot auf dem Mittelmeer zu sitzen. Einer der Bewohner und Freund von mir, von dem ich wusste, dass auch er kein französisch spricht, guckt mich an und sagt: No compris und geht, ich hinterher. Das ganze Festival wurde ohne Refugees durchgeführt. Sie wurden nicht eingeladen Barschichten zu übernehmen, noch auf die Bühne zu gehen und ihre Perspektive zu beschreiben. Das Festival war eine schöne Idee, nur nicht für die Bewohner*innen. Letztendlich haben wir angeboten, für das Festival zu kochen und Alle zur Planung und zum Kochen eingeladen. Als ich auf vegane Küche bestand und so aufzählen musste, was ich alles nicht esse, erinnerte mich die Reaktion von Tamara an die meiner Oma.
Eines Nachts werden wir geweckt. Eine Familie, die in Caen lebt, soll abgeschoben werden. Fünfzehn Minuten später sitzen eine Freundin und ich im Auto, wir fahren zu dem Hotel, wo die Familie derzeit untergebracht ist. Wir wissen nicht, was passieren wird, sind aufgeregt. Als wir ankommen treffen wir einige der Aktivistis, die wir aus dem Squat kennen und gesellen uns zu ihnen. Wir stehen ein bisschen blöd daneben, weil wir sie nicht verstehen können und albern rum, dabei ist mir flau im Magen. Sternenklarer Nachthimmel über uns. Wir gehen in die Bar des Hotels, wo drei Cops stehen und Kaffee trinken. Wir stellen uns in einigem Abstand davon auf und beobachten sie, angespannt. Nach einer halben Stunde ist es soweit, die Polizisten passieren unsere Gruppe, um durch den Hinterausgang zur Tür der Familie zu gehen. Alle hinterher. Glücklicherweise darf die Polizei die Wohnung nicht betreten. Die Familie sich jedoch nicht wiedersetzen, sonst riskieren sie drei Jahre Gefängnis. Dann ganz viel Gerede, ich verstehe kein Wort. Als der eine den Versuch macht näher an die Tür zu kommen, fange ich an zu filmen. Die Polizei im Einsatz zu filmen, ist legal. Er schleudert herum und greift in Richtung meines Handys. Sofort stellen sich zwei Leute schützend vor mich, es eskaliert zum Glück nicht, aber die Stimmung ist angespannt. Nach weiterem Wortwechsel ziehen sie irgendwann ab. Wir helfen Hab und Gut aus dem Zimmer in einen Sprinter zu räumen, der die Familie an einen „sicheren Ort“ bringen soll. Langsam wird es echt kalt. Ich bin glücklich, dass alles so ruhig verlaufen ist und wir fahren heim.
Wenn wir abends, sobald die Kinder den Platz geräumt haben, die Frisbee oder den Fußball auspacken, später reingehen, reden, Karten oder Ludo spielen, Bier trinken, sind wir einfach Freund*innen, die im Schein der Lampe vergessen, was sie hier hat zusammenkommen lassen. Für mich sind das die schönsten Momente, in denen die Unterschiede und der Frust über die Situation verschwunden zu sein scheinen. Frustration ist ein Gefühl, in dem sich Resignation und Wut vermischen, so fühlt sie sich zumindest für mich an. Und selbstverständlich zieht sie nicht spurlos an Menschen vorbei. So gibt es hier leider Fälle von Alkoholabhängigkeit, Depression oder Psychosen. Umgang damit zu haben, kann sehr aufreibend sein, sie zu unterstützen, sich zu unterhalten jedoch motivierend. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass auch der Squat leider kein Raum frei von Sexismus, Nationalismus oder Rassismus ist. Einer meiner Freunde wurde aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt und Frauen* erzählen manchmal davon, dass sie angebaggert werden oder es fällt einer dieser „… ist für Mädchen/Frauen“ – Sprüche. Anders als es einige gern auslegen, wäre es aber schlichtweg falsch solch ein Verhalten Allen zu unterstellen, zumal die Opfer dessen andere Squatbewohner*innen sind.
An unserem letzten Abend sitzen wir um die Feuertonne, in der aus Zwecken der Luftzufuhr und Dekoration das „A“ im Herzen eingeritzt ist. Einige essen noch die Überbleibsel, es wird getrunken, geraucht, gesungen und gelacht. Die Stimmung ist gut. Es laufen im Wechsel Lieder, die sich im Laufe der Zeit zu unserer Musik etabliert haben und die wir deshalb gemeinsam singen können und Songs in den verschiedenen Sprachen, zu denen die entsprechenden Personen ihre Performance zum Besten geben. Es werden uns drei Karten zugesteckt, auf denen kleine Botschaften oder Dankesgrüße zu lesen sind. Ich bin ein bisschen gerührt.
Hier im verregneten Deutschlandsehe ich einzelne Bilder noch deutlich vor mir, kann mir die Stimmen, dieGeräusche ins Gedächtnis rufen. Ich sitze in unserer Küche und rede mit meinerWG über die Uni und dass unsere Küche mal wieder aufgeräumt werden müsste. Wennmich Leute fragen, erzähle ich von den verschiedenen Leuten, auf die ichgetroffen bin, die ich kennenlernen konnte. Mit jeder neuen Bekanntschaft habeich am meisten eigentlich über mich selbst und meine Verortung in der Weltgelernt und bin immer wieder an Punkte gekommen, an denen ich mich mit Leutenidentifizieren konnte. Ich bin erschöpft und habe mein eigenes Zimmergebraucht, aber ich werde wieder hinfahren. Uns wurde schon eine Ankunftspartyversprochen – natürlich mit veganem Essen.
Der*Die Autor*in zieht es aus Gründen der Kriminalisierung vor Anonym zu bleiben.





![Für Buchvorstellung: Mail an nobordernoproblem[ät]posteo.de](https://nobordernoproblem.org/wp-content/uploads/2019/08/973F2C08-EDDC-44A4-A4E2-19FE4CEFF44D-700x1130.jpeg)





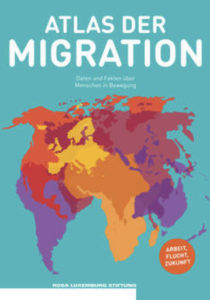

Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.